Jan Knupper
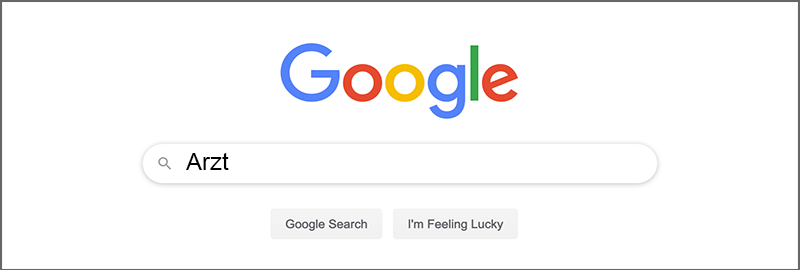
Ist Google frauenfeindlich? Das Ranking für bestimmte Keywords kann durchaus diesen Verdacht wecken. Doch das Phänomen der Ungleichbehandlung liegt letztlich nicht an den Algorithmen, sondern an einem grundsätzlichen Problem der deutschen Sprache. Und wer will, kann selbst dafür sorgen, dass die Ergebnisliste diskriminierungsfrei ist.
Sexistische Algorithmen bei der größten Suchmaschine? Diese Meldung lässt aufhorchen. Tatsächlich gibt es Untersuchungen, die belegen, dass Websites von Frauen schlechter ranken als die von Männern – aus dem einfachen Grund, dass die nachrangigen Websites von Frauen betrieben werden. Wer zum Beispiel nach einem „Arzt“ sucht, bekommt tendenziell mehr Seiten von männlichen Medizinern gelistet als von weiblichen.
Wie ist das im Zeitalter der Gleichberechtigung möglich? Schuld ist eiskalte Maschinenlogik – aber auch der Gebrauch der deutschen Sprache im Alltag.
Grundsätzlich besteht ein Kriterium für das Google-Ranking darin, wie häufig ein bestimmtes Wort auf einer Webpräsenz auftaucht. Und da macht es eben einen Unterschied, ob die Robots im Quelltext einer URL öfter „Arzt“ als „Ärztin“ finden. Die Lösung dieses Problems ist wenig befriedigend:
Auch für die Suchenden ist das Problem nur mit zusätzlichem Aufwand zu beheben:
Übrigens gilt dieses Problem auch umgekehrt. Die Suche nach „Ärztin“ verweist die männlichen Ärzte auf die hinteren Plätze. Eigentlich verständlich. Denn wer nach einer Ärztin sucht, möchte ja meist ausschließlich eine Frau finden, die eine medizinische Praxis betreibt.
Wer aber speziell nach einer weiblichen Medizinerin sucht, muss sich eigentlich für den Such-Term „Ärztin -Arzt“ entscheiden. Mit dem Minus unmittelbar vor einem Wort wird dieses bei der Suche bekanntlich ausgeschlossen. Damit schließt der User beziehungsweise die Userin aber eigentlich nur diejenigen Ärztinnen aus, die intelligentes SEO betreiben. Konsequenterweise müsste dann jede Ärztin entscheiden,
Ein grundsätzliches Problem der deutschen Sprache wird somit zur Herausforderung für die Google-Programmierer und zu einer neuen Einnahmequelle von SEO-Agenturen.
Es wäre technisch kein Problem, wenn Google die beiden Begriffe „Arzt“ und „Ärztin“ ganz einfach vollkommen gleichstellen würde. Bisher tut die Suchmaschine dies aus gutem Grund aber nicht. Denn auch diese Lösung wäre kaum benutzerfreundlicher. So würde zum Beispiel die Eingabe „Ärztin -Arzt“ komplett sinnlos.
Das Problem hat wenig mit Sexismus, aber viel mit Mengenlehre zu tun. Normalerweise schließt eine männliche Berufsbezeichnung auch die weiblichen Berufsausübenden ein:
Aber umgekehrt gilt dies nicht:
Die männliche Form hat eine einschließende Funktion, die weibliche eine ausschließende. So verstehen wir unsere Sprache. Zumindest die meisten Sprachteilnehmer*innen verstehen dies so. Seit den 1970er Jahren gibt es viele Versuche, diese sprachliche Ungerechtigkeit und Ungenauigkeit auszugleichen.
Bisher ist noch keine Lösung gefunden worden, die ohne logische Fallstricke auskommt und dabei nicht gleichzeitig das Gefühl für sprachliche Ästhetik verletzt. Alle Texterinnen und Texter, die mit einer konsequent geschlechtsneutralen Formulierung eines Artikels beauftragt werden, wissen ein Lied davon zu singen. Entweder wird das Ergebnis unlogisch, frauenfeindlich oder komplett unlesbar.
SEO-Experten empfehlen eine recht einfache Lösung: den Bindestrich. Die Texterin wird auf ihrer Website zur Texter-in. Das ist nach Duden zwar nicht erlaubt, bringt aber die Google-Liste in ein gendergerechtes Gleichgewicht. Leider kann die Ärztin damit wenig anfangen. Denn neben dem zusätzlichen „in“ ist ihr Anfangsbuchstabe zum Umlaut geworden. Macht sie sich zur Arzt-in, outet sie sich als Legasthenikerin.
Man und frau sieht also: Wenn sich an einer Stelle eine Lösung zeigt, lauert eine neue Schwierigkeit hinter der nächsten Ecke. Das Problem ist in der Praxis jedoch nicht so gravierend, wie es auf den ersten Blick scheint. Wer selbst einmal einen Test macht, sieht schnell, dass die Unterschiede in den Ergebnissen zwar messbar, aber nicht unbedingt auffällig sind. Im Übrigen verschwindet die Ungleichbehandlung fast völlig, wenn die Suche nochmals nach zusätzlichen Kriterien eingegrenzt wird.
Vielleicht bringt künstliche Intelligenz die Lösung. Google setzt bekanntlich auf KI bei der Entwicklung neuer Suchalgorithmen. Keywords treten in den Hintergrund, die wahre Suchintention immer mehr in den Vordergrund. Dann wird es in naher Zukunft kein Problem mehr sein herauszufinden, inwieweit die männliche oder weibliche Form bei einem Suchbegriff Relevanz für den User oder die Userin hat. Und dann haben auch Arzt und Ärztin bei Google völlige Chancengleichheit.
Jan Knupper